“Polarisierung kann auch wertvoll sein für eine demokratische Auseinandersetzung.”
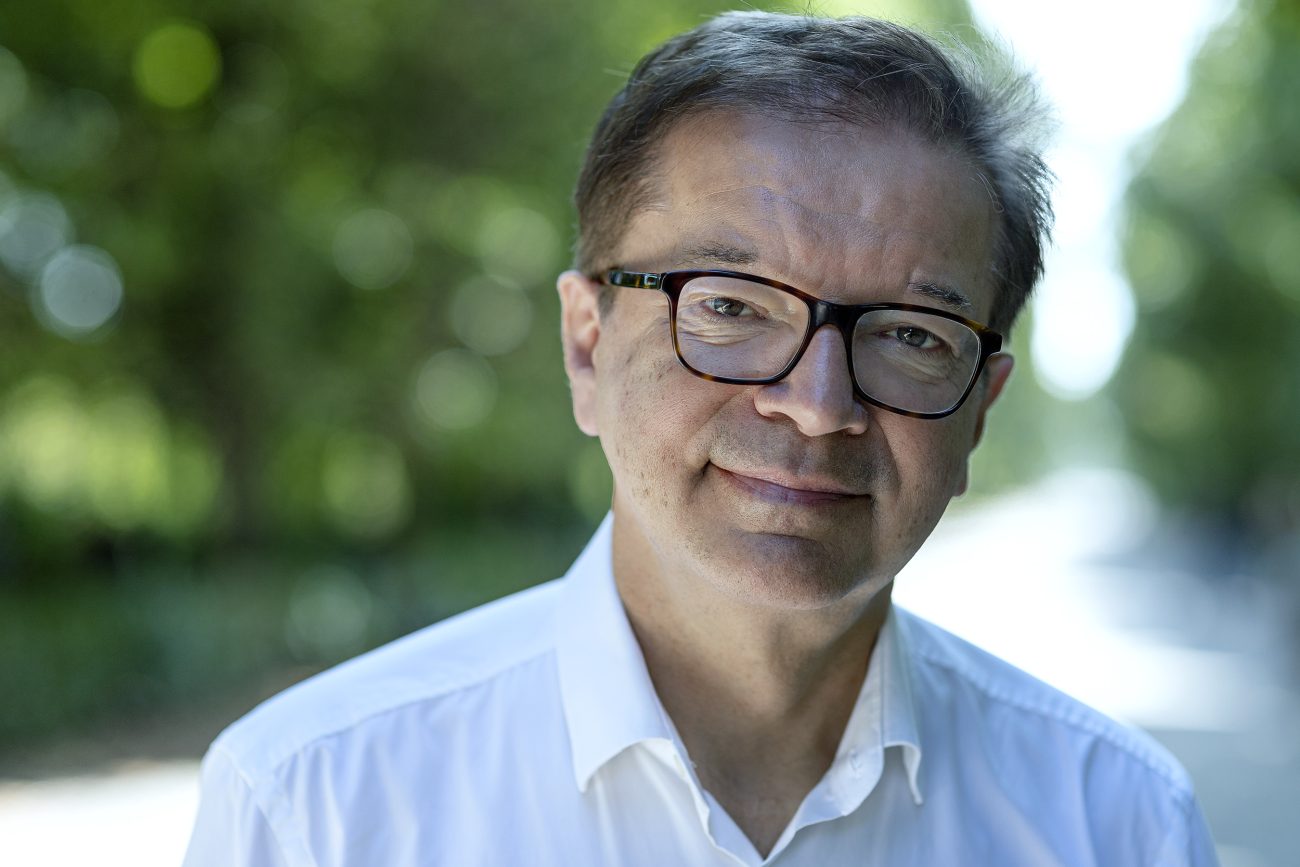
Rudolf Anschober im Gespräch mit Hans Peter Graß
Im Rahmen der Tagung „Gespalten?“ führt Julia Herrnböck (Dossier) ein lebensgeschichtliches Interview mit Rudolf Anschober. Das Interview stammt aus der Kranich-Ausgabe 2/2023.
Kranich: In Ihrem Buch „Pandemia“ beschreiben Sie zwei Situationen: März, April 2020: Ausbruch der Pandemie, große Solidarität in der Bevölkerung, große Harmonie der politischen Akteur*innen in Bezug auf Maßnahmen und öffentliche Auftritte nach außen. Im November desselben Jahres schreiben Sie: „Nun regiert die Spaltung!“ Was verstehen Sie unter diesem Begriff der Spaltung?
Rudolf Anschober: Spaltung ist für mich keine Divergenz oder eine unterschiedliche Einschätzung, sondern eine Situation, in der keine Kommunikationsbrücken mehr bestehen, in der man nicht mehr miteinander reden kann, wo es kein Verständnis füreinander gibt und auch an eine völlig andere Wirklichkeit glaubt, das heißt von einem diametral anderen wissenschaftlichen Erkenntnisbild ausgeht.
Kranich: Lassen sich da Zusammenhänge erkennen zwischen dieser anfänglichen Form von Solidarität und Harmonie und den darauffolgenden extremen Spaltungsprozessen. Muss man diese beiden Aspekte vielleicht sogar zusammen denken?
Rudolf Anschober: Harmonie war das meiner Einschätzung nach nicht. Es ging eher darum, eine einheitliche Krisenkommunikation zu verwirklichen, die auch Sicherheit ausstrahlen sollte, soweit das in einer solchen Situation möglich ist, weil sehr viel Menschen extrem beunruhigt waren. Hinter den Kulissen hat es sehr wohl Auseinandersetzungen gegeben über den richtigen Kurs oder die Form der Kommunikation. Mir war immer wichtig, eine Kommunikation zu praktizieren, die weitgehend angstfrei war und eher auf Perspektive auf Optionen, auf Lösungsansätze setzt. Da hatten wir ganz offensichtlich unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen, wie man es bei manchen öffentlichen Auftritten wohl auch gemerkt hat.
Für mich war der Weg ein sehr klarer. Wir standen alle in einer völlig neuen Situation, die keine*r von uns, weder die Regierenden, noch die Opposition, noch die Betroffenen, noch die Behörden, noch die Mitarbeiter*innen in den Spitälern jemals erlebt haben. In dieser Situation ist eine Form der Solidarität gewachsen, weil wir gespürt haben, dass wir nur dann gut durch die Krise kommen, wenn die Bevölkerung zusammenhält und vom Wissen geleitet werden, dass es uns nur gut geht, wenn es auch dem anderen gut geht, wenn es also ein solidarisches Zukunftsbild gibt.
Das ist dann im ersten Sommer zerbrochen. Meiner Meinung nach aus drei Gründen. Zum einen durch das sogenannte Präventionsparadoxon. Ich erlebe einen Erfolg meiner Bemühungen, wodurch das Negative, das ich durch die Prävention vermeiden wollte, so nicht eintritt. Daraufhin sagen sehr viel Betroffene, das war gar nicht so schlimm und wir hätten das wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Das zweite war eine Verparteipolitisierung, Das heißt, es ist weggegangen von einer solidarischen gemeinsamen Präventionsarbeit hin zum Mitdenken des parteipolitischen Nutzens. Das dritte betraf ein Phänomen, bei dem ich eigentlich selber noch nicht wirklich zu Ende gekommen bin mit meiner Einschätzung, wie man damit umgehen soll: Das sind diese verschiedenen Verschwörungstheorien, die sich ab diesem Zeitpunkt öffentlich verstärkt gezeigt haben. Ich habe erst bei der Recherche zu meinem Buch registriert, dass die meist schon lange da waren und die Pandemie nur ein Verstärker war. Da frage ich mich heute noch, wie es möglich ist, da einen konstruktiven Diskurs zu führen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse einfach nicht zu Kenntnis genommen werden. Und da ist das passiert, was ich unter Spaltung verstehe. Da gibt’s einen tiefen Graben, wo wir offensichtlich kein Verständnis mehr füreinander haben.
Kranich: Polarisierung ist ja gelegentlich auch ein politisches oder mediales Konstrukt, das versucht, Schwarz-Weiß-Bilder zu konstruierten und dadurch Differenzierungen, Ambivalenzen und Ambiguitäten in den Hintergrund zu drängen. War das für Sie ein Widerspruch in der politischen Praxis differenziert zu bleiben und trotzdem auch Haltung zu zeigen und sich zu positionieren?
Rudolf Anschober: Für mich ist Polarisierung etwas anderes – nämlich die Sichtbarmachtung eines gravierenden Meinungsunterschieds. Zum Beispiel die Frage, ob man einer Pandemie eher nach dem schwedischen Weg oder dem asiatischen Weg begegnen soll. Die Unterschiede dieser Positionen herauszuarbeiten, halte ich demokratiepolitisch für wichtig. Der große Unterschied ist, in welcher Kultur der Auseinandersetzung das passiert. Gibt es noch so etwas wie ein Grundverständnis füreinander, die Annahme, dass der oder die andere auch etwas Positives will oder gibt es die Grundunterstellung, das andere sei alles Unsinn, bösartig, zerstörerisch. Dann kommuniziert man entweder gar nicht mehr miteinander oder auf eine unglaublich aggressive Art und Weise. Das ist der Unterschied zwischen einer Polarisierung, die wertvoll sein kann für eine demokratische Auseinandersetzung und einer Spaltung, die zerstörerisch ist im Sinne einer Verunmöglichung von Kommunikation.
Kranich: Hartmut Rosa nennt die Pole als Voraussetzung für einen Resonanzraum, in der es erst zu Schwingungen kommen kann. Schwingungen, die ja notwendig sind, um zu kommunizieren. Kennen Sie auch Situationen, in denen Polarisierung demokratische Prozesse erst angeschoben und forciert hat oder sogar beziehungsstiftend war?
Rudolf Anschober: Ich habe das zum Beispiel bei meinen Lesungen erlebt. Der Resonanzraum, der für mich auch sehr viel mit Zeit haben zu tun hat, den habe ich in meiner Zeit während der Pandemie nicht gehabt. Das hat mir persönlich sehr gefehlt. Ich habe dann den Schritt gemacht, dass ich meine Kritiker*innen zu den Lesungen eingeladen habe und viele sind auch gekommen. Das waren harte Auseinandersetzungen – aber für mich unglaublich interessant. Es hat auch Kritiker*innen gegeben, die dann bei mehreren Veranstaltungen waren, weil sie diesen Diskurs, diese Form der Polarisierung, das Sichtbarwerden dessen, was unsere Meinungsverschiedenheit ausgemacht hat, für so spannend empfunden haben. So ist es auch mir gegangen. Das ist das, was ich mir unter Evaluierung vorstellen würde. Nicht, dass wir einmal im Fernsehen ein Bürgerforum haben, in dem zwanzig Leute miteinander sprechen, sondern dass wir in diesem Land einen Diskurs vor Ort haben, weil eine Pandemie nur stellvertretend dafür ist, wie man in unserer Gesellschaft mit großen Krisen und Brüchen umgeht.
Kranich: Wie geht’s Ihnen mit der öffentlichen Präsentation von Ambivalenzen? Sie sind ja auch eine Person, die nicht nur eine Position vertritt, sondern auch eine, die in Bewegung ist.
Rudolf Anschober: Ich hatte aus meiner Sicht in der Krise eine andere Aufgabe. In diesem Fall ist es die, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, dass möglichst wenige Menschen sterben oder erkranken. Das ist in einer Pandemie die Hauptaufgabe. Dazu gehört, dass es auch eine Form der Krisenkommunikation gibt, die zusammenführt. Mit dem Ziel zu signalisieren, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir in dieser Situation Zusammenhalt brauchen. Insofern war das eine spezielle Situation.
Kranich: In Ihrer Abschiedsrede haben Sie aber auch von Ihrer Unsicherheit und Ihrer Verletzbarkeit gesprochen. Kann man sich das erst im nach hinein leisten?
Rudolf Anschober: Nach den Lesungen sind Leute zu mir gekommen, die mir signalisiert haben, dass es ihnen wichtig war, dass ich als Minister im Krisenmanagement den Eindruck vermittelt habe, einen klaren Plan zu haben. In einer derartigen Situation bleibt zu wenig Zeit für Differenzierung. Ich habe damals versucht, Ruhe auszustrahlen, auch wenn mir das manchmal schwergefallen ist, weil ich mir selbst manchmal unsicher war. Außerdem wollte ich eine positive Zukunftsperspektive mittransportieren.
Kranich: Am Schluss Ihres Buches schreiben Sie: „Es muss gelingen, gespaltene Gesellschaften wieder zusammenzuführen, uns gegenseitig zu verzeihen, aber jene ins Abseits zu stellen, die die Angst vor Veränderung… für parteipolitischen Profit missbrauchen.“ Wie darf man das verstehen? Wo ziehen Sie da die Grenze des Dialogs?
Rudolf Anschober: Für mich geht’s um die Frage, ob es die Bereitschaft gibt, den anderen zu respektieren mit seinen Meinungen und ihren Positionen. Ich habe in der letzten Woche dreißig oder vierzig Emails erhalten, die von totaler Aggression, von Bedrohungen, Verleumdungen und Verwünschungen geprägt waren. Da gibt es keinen Raum mehr für Diskussion. Da sag ich ganz klar, so geht das nicht, so kann man nicht miteinander umgehen. Aber die große Mehrheit der Kritikerinnen und Kritiker, die einzelne Maßnahmen abgelehnt hat oder sich mit manchen Stoffen nicht impfen lassen wollten, mit anderen schon, ist gesprächsbereit. Diesen Dialog müssen wir führen, mit denen müssen wir wieder lernen uns gegenseitig zuzuhören. Die Grenze ist dort, wo an Verschwörung geglaubt, Wissenschaft geleugnet, gehetzt und der Dialog verweigert wird.
Kranich: Wir danken für das Gespräch.
Rudolf Anschober war grüner Politiker, Gesundheits- und Sozialminister und arbeitete 18 Jahre in Regierungen. Er ist derzeit als Autor und Vortragender tätig. In seinem Buch „Pandemia“ schildert die Herausforderungen des Ausnahmezustandes unter Corona.
Foto: Ulrik Hölzel
